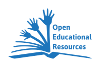Brecht: Der Radwechsel
(Erschließung eines lyrischen Texts)
Bertolt Brecht: Der Radwechsel
Ich sitze am Straßenhang.
Der Fahrer wechselt das Rad.
Ich bin nicht gerne, wo ich herkomme.
Ich bin nicht gerne, wo ich hinfahre.
Warum sehe ich den Radwechsel
Mit Ungeduld?
[Die folgende Erschließung des Gedichts ist bewusst ohne den Einfluss biographischer Hintergrundinformationen erstellt. Ein solcher Einfluss könnte eine Deutung ermöglichen, die stärker auf die Entstehungssituation Bezug nimmt. Das Gedicht kann dann auch als ein geschichtliches Dokument gewertet werden (sowohl in Bezug auf die Geschichte des Autors als auch in Bezug auf die politische Situation der Entstehungszeit). Die Einleitung, die zusammenfassende Deutung oder vor allem der Schluss bieten Raum für eine solche Deutung. Ziel des vorliegenden Textes ist es aber, die Wirkung des Gedichtes auf den Interpreten so zu erläutern, dass andere Leser diese Wirkung nachvollziehen können. Entscheiden Sie bitte, ob bzw. inwiefern das gelungen ist.]
[1. Einleitung: Die Panne auf der Fahrt]
Das Bild eines Menschen, der nach einer Panne an einer Überlandstrecke auf seine Weiterfahrt wartet, zeichnet Bertolt Brecht in seinem Gedicht „Der Radwechsel“. Während der Wartezeit kommt der Sprecher zur Ruhe, der Leser erhält einen kurzen Einblick in seine Gefühlswelt – und das, obwohl Brechts Gedicht nur sechs kurze Zeilen umfasst.
[2. Hauptteil] [2.1. formaler Überblick: Moderne Formgebung]
Jene sechs kurzen Zeilen sind zu einer einzigen Strophe geformt. Ihnen fehlt jedoch fast alles, was im Volksmund ein Gedicht traditionell auszeichnet: sie lassen sowohl einen regelmäßigen Rhythmus als auch jeglichen Reim vermissen. Sie wirken fast wie ein „Sinnspruch“ und sind zusammengenommen dennoch knapp zu lange, um als Graffiti an einer Bahnhofsunterführung zu enden. Die genannten formalen Beobachtungen sind schon ein starker Hinweis auf eine moderne Formgebung. Die ersten vier Verse beherbergen jeweils einen kompletten Satz, lediglich bei den beiden letzten Versen übergreift der Satz den Zeilensprung. Während die ersten vier Sätze Aussagesätze sind, ist dieser letzte Satz als eine „Warum?“-Frage formuliert. Aufgrund der Kürze des Gedichts fällt zudem der Parallelismus im dritten und vierten Vers besonders ins Auge: „Ich bin nicht gern, wo ich herkomme / Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre“. Allein aufgrund dieser Beobachtung ist die Vermutung auszusprechen, dass dieses Stilmittel für das Gedicht über eine zentrale Bedeutung verfügt.
[2.2. Erschließung der Strophe: Nachdenken über die Ungeduld]
Der Sprecher tritt im Gedicht explizit als „Ich“ auf und beginnt mit der Aussage, dass er am Straßenhang sitze. Dabei steht das „Sitzen“ durchaus im Kontrast zu dem, was man mit der Umgebung der Straße verbindet, nämlich die Fortbewegung, unter Umständen auch den Lärm der vorbeifahrenden Automobile. Hier hingegen wird ein Bild gezeichnet, das einen solchen Lärm nur schwer vorstellbar erscheinen lässt. Die kurzen, doch zugleich überlegt formulierten Sätze lassen eher darauf schließen, dass der Sprecher in dieser Situation zur Ruhe kommt. Brecht verwendet in diesem Gedicht keine Adjektive und vermeidet damit, diese Situation konkreter auszugestalten. Vieles bleibt daher der Vorstellung im Kopf des Lesers überlassen. Dass es sich um einen „Hang“ handelt, der die Straße deutlicher vom Rest der Landschaft trennt, lässt vor den Augen vieler Leser vielleicht einen kleinen Mikrokosmos entstehen: Eine wenig befahrene Straße, ein Pannenfahrzeug, aber der Blick endet am Straßenhang, an dem der Sprecher sitzt. Von der Landschaft dahinter ist nichts zu erkennen, nur der Himmel darüber. Wie der Himmel an diesem Tag aussieht, bleibt der Vorstellung des Lesers vorbehalten.
Unter Umständen wird das Bild der Ruhe dadurch erzeugt, dass der Sprecher unbeteiligt am Straßenhang sitzt, während der Fahrer das Rad wechselt (Z. 2). Bislang ist unklar, ob die Situation für ihn unangenehm oder doch eher angenehm ist, doch dieses Bild wird durch die in Zeile drei und vier folgenden Verse zerstört. Diese Verse zeichnen sich durch einen Parallelismus aus, nur das Prädikat des Nebensatzes ist verändert. Gerade durch die Tatsache, dass es am Vers- und Satzende steht, wird es nochmals in besonderer Weise hervorgehoben. Brecht verwendet eine fast mathematische Konstruktion, um hiermit aufzuzeigen, dass sein Sprecher weder am Ausgangspunkt seiner Reise noch an deren Zielpunkt gerne ist. Während nach dem dritten Vers („Ich bin nicht gerne, wo ich herkomme“) noch die Möglichkeit der Vorfreude auf das Ende der Reise vorhanden ist, manifestiert sich im vierten Vers die Ernüchterung: Das Ziel der Fahrt ist nicht erstrebenswert.
Das ist die Basis, auf der sich die entscheidende Frage (Z. 5/6) erhebt. Der Sprecher stellt sie sich selbst, in einem Moment der Erkenntnis reflektiert er über seine Ungeduld. Die Frage ist gleichzeitig als rhetorische Frage zu verstehen, denn es ist völlig unklar, warum der Reifenwechsel überhaupt mit Ungeduld erwartet wird, wenn weder Ausgangs- noch Endpunkt der Reise erstrebenswert scheinen. Dass über die Ungeduld reflektiert wird, erfährt der Leser erst in der letzten, nur die Präposition „mit“ und das Substantiv umfassenden Zeile. Man könnte sagen, dass diese letzte Zeile das zuvor gezeichnete Bild in Frage stellt – schließlich könnte man meinen, der unzufriedene Sprecher habe bei dieser Panne alle Zeit der Welt, hier aber wird deutlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist – und aber gleichzeitig vervollständigt, denn sie dient dem Gedicht gleichsam als Pointe. Es ist ganz offensichtlich, dass es paradox ist, ungeduldig zu sein.
[2.3. Zusammenfassende Deutung: Die Panne – Glücksfall oder Verhängnis]
Der Sprecher realisiert, während er am Straßenhang sitzt, dass es eigentlich paradox ist, ungeduldig zu sein, weil er – unter Umständen erst in diesem Moment – versteht, dass er weder seinen Ausgangspunkt, noch sein Ziel als einen Ort ansieht, an dem er gerne verweilt. Natürlich stellt sich die Frage, ob darunter wirklich konkrete Orte verstanden werden oder sie metaphorisch für sein Leben stehen können. Sicherlich ist beides möglich. Egal, ob real existierende Orte gemeint sind, oder der Sprecher seinen gesamten Lebensentwurf diskutieren will: das Gedicht beschreibt die Unmöglichkeit, einen Zeitpunkt als „schön“ zu empfinden, wenn man zwischen einem unschönen Start und Ziel „gefangen“ ist. Trotzdem hat das von Brecht in „Der Radwechsel“ entworfene Bild etwas Heroisches: In einem Moment der Ruhe und der Reflexion gelangt der Sprecher zur Erkenntnis, dass es ihm nicht mehr möglich ist, genau diesen Augenblick zu genießen, weil er ein Gefangener dessen ist, was in seinem Leben passiert.
[3. Schlussgedanke: Die Panne als Wendepunkt?]
Man könnte sich gut vorstellen, dass ein Maler ein Bild zu genau diesem Gedicht hätte zeichnen können. Für die Mimik der am Straßenhang sitzenden Person bieten sich zwei Alternativen an. Auf der einen Seite ein etwas resignierter Blick, unter Umständen gedankenverloren, der genau jenen Moment einfängt, in dem sich diese Person über ihre Situation bewusst wird. Auf der anderen Seite könnte aus der Erkenntnis der eigenen Situation während der Panne auch ein Wendepunkt werden. Dann würden die Gesichtszüge entschlossen sein, sich die Resignation, die aus der dritten und vierten Zeile des Gedichts spricht, in Tatkraft verwandeln. Dass die Frage in den Zeilen fünf und sechs so gestellt ist, dass sie sich selbst beantwortet, deutet darauf hin, dass der Sprecher zwar noch über seinen Gefühlszustand reflektiert, gleichzeitig aber die Notwendigkeit sieht, etwas zu ändern – sei es auch nur, die Möglichkeit wahrzunehmen, die Zeit des Radwechsels als willkommene Unterbrechung der Fahrt zu nutzen.
(c) M. Rödel