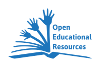|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | 1. Definieren Sie knapp den Begriff „Ethnogenese“.
| |
| | | | |
| − | Ethnogenese bezeichnet die Entstehung eines Volkes (2). Darunter fällt auch der Austausch und die Durchmischung mit anderen Kulturgruppen (keine festen Wanderungsverbände in der Völkerwanderung, traditionelle „Volksidee“ als Konstrukt). (2)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 2. Beschreiben Sie den im Anhang abgebildeten Holzstich und interpretieren Sie ihn. Gehen Sie dabei auch auf das beigefügte und hier in modernen Lettern abgedruckte Gedicht (Gesamtaussage, keine Einzelinterpretation) ein.
| |
| − |
| |
| − | (7) Im Mittelpunkt des Bildes steht ein Mann in Kampfrüstung mit entschlossenem Blick, der auf einem Pferd reitet, das kampfbereit, wild und ebenfalls entschlossen dargestellt wird. Auf dem Boden liegt ein unterlegener, in Rüstung gekleideter Soldat. (evtl. Sonderpunkt, mit dem das Fehlen eines anderen Punktes ausgeglichen werden kann: Hintergrund: weitere Kämpfer). Das Gedicht beschreibt ergänzend dazu die Arminiusschlacht (Titel: Arminius) als einen heroischen Sieg über die Römer und lässt Arminius hochleben.
| |
| − |
| |
| − | (5) Das Bild dient der Mythenbildung um Arminius (=2), der als Held des Bilds und des Gedichts erscheint (Merkmale/Hinweise: wilde Entschlossenheit, die sich durch nichts aufhalten lässt, Rüstung des auf dem Boden liegenden Soldaten deutet auf einen Römer hin, Darstellung im Gedicht als junger Führer einiger germanischer Stämme, der die Römer in die Flucht schlägt, und damit einen großen deutschen Sieg herbeiführt) (3).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 3. Zeigen Sie auf, dass mit diesem Gedicht ein Mythos bedient wird, indem Sie zwei Textstellen Ihrer Wahl dem heutigen geschichtlichen Wissen gegenüberstellen.
| |
| − |
| |
| − | ''im Teutoburger Wald'' Nach heutigem Wissen hat die Schlacht nicht im Teutoburger Wald stattgefunden, sondern in Kalkriese bei Osnabrück (2). Die Information beruht auf einer Quellenüberlieferung bei Tacitus, Ausgrabungen haben jedoch neue Erkenntnisse gebracht (2).<br />
| |
| − | ''Des deutschen Mannes''
| |
| − | ''den Deutschen'' Man kann nicht davon sprechen, dass es sich um „deutsche“ Kämpfer handelte (1), sondern es waren germanische Stämme, die aber keine direkte Vorläufer der „Deutschen“ waren (1) Ethnogenese (1), zudem war Arminius in römischen Diensten ausgebildet worden (1).<br />
| |
| − | ''Und der zerbrach der Römer Joch, -'' Aufgrund des regen kulturellen Austauschs ist nicht unbedingt klar, dass die Herrschaft der Römer als „Joch“ empfunden wurde… (2)
| |
| − | oder
| |
| − | Varus und seine Truppen befanden sich nicht in einem Eroberungszug, der weite Teile Germaniens unterwerfen sollte (2)
| |
| − | oder
| |
| − | Auch nach der Niederlage drangen die Römer offenbar noch dauerhaft in germanisches Gebiet ein, wie neue archäologische Erkenntnisse vom Harzhorn verraten (2)
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 4. Stellen Sie eine Hypothese auf, wann der (angesprochene) Holzstich (in der Anlage) mitsamt Gedicht entstanden sein könnte, und begründen Sie diese.
| |
| − | Entstanden ist der Stich um 1900 (1).
| |
| − | Begründung: Nationale Begeisterung nach der Reichsgründung 1871, Berufung auf die Legitimationsfunktion des Herrmanns-Mythos (Legitimation zur Weltmacht, Legitimation zur gemeinsamen Nation) – glorreiche Wurzeln werden möglichst weit zurück in der Geschichte gesucht (3).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 5. Diskutieren Sie den aktuell gültigen Nationsbegriff in Deutschland. Gehen Sie dabei auf die Aussage von Bundespräsident Wulff vom 3. Oktober 2010 ein, dass neben dem Judentum und dem Christentum auch der Islam zu Deutschland gehöre.
| |
| − |
| |
| − | D: Definition von „Kulturnation“ und „Staatsnation“ (4) – entweder (bessere Variante) explizit oder implizit im gesamten Text der Aufgabe.
| |
| − |
| |
| − | S: Argumentative Struktur (historisches Argumentieren): Diese Punkte werden vergeben, wenn These und Argument zusammenpassen. (2)
| |
| − |
| |
| − | A: Kulturnation, da der Begriff „deutsch“ immer ethnisch (z.B. Beherrschung der Sprache von Geburt an) definiert wurde und im Volksmund auch noch wird. Bezüglich Wulffs Aussage kann nun diskutiert werden, dass er sich der Vorstellung der „Staatsnation“ bedient (kein vorstaatlicher Nationsbegriff, sondern Nationszugehörigkeit durch aktives Bekenntnis). Ebenfalls für Staatsnation spricht das neue Staatsbürgerschaftsrecht (Integrationsdebatte). Gleichzeitig könnte man aber auch von einer Neudefinition des Begriffs „Kulturnation“ berechtigerweise mit dem Argument sprechen, dass eine Zugehörigkeit zur Nation über die Annahme der deutschen Kultur (Merz: „Leitkultur“ mit der Sprache als wesentlichem Element) erworben wird. (6)
| |